Der Fachkräftemangel verschärft sich: Will Deutschland die drei „Ws“ aufrechterhalten (Wertschöpfung, Wachstum, Wohlstand), müssen Wirtschaft und Politik zusammenarbeiten. Ein Hebel: Das „Gesetz zur Stärkung der Chancen durch Qualifizierung“ (alltagssprachlich bekannt als Qualifizierungschancengesetz). Der IT-Branchenverband Bitkom hat die wichtigsten Punkte als Leitfaden veröffentlicht: Ich gebe euch hier auf meinem Fachblog „Der Onliner – Marketing & Wirtschaft 4.0“ einen Überblick.
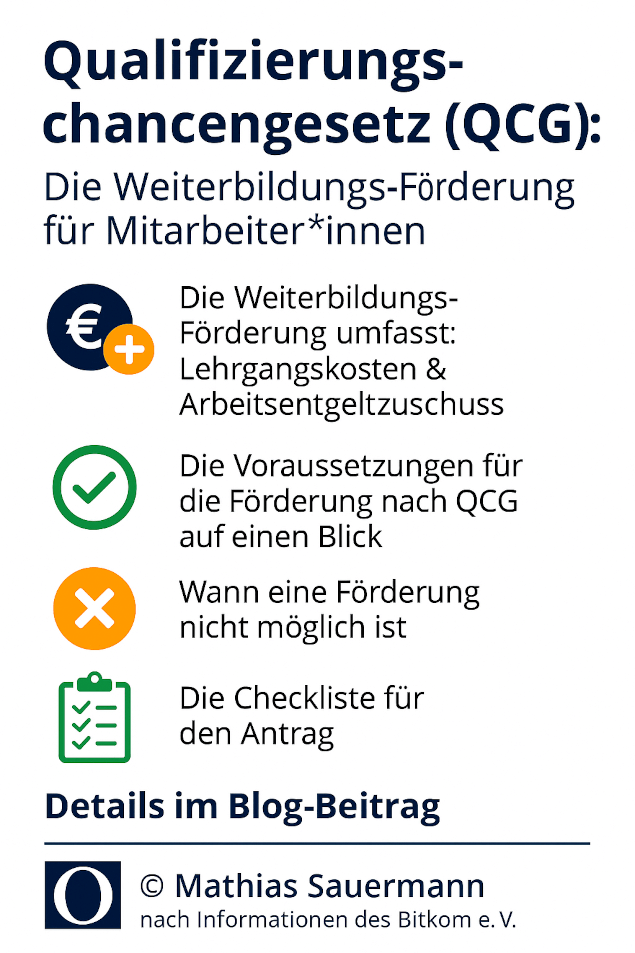
Die Themen meines Blog-Beitrags auf einen Blick:
- Wer steht hinter dem Leitfaden zum Qualifizierungschancengesetz (QCG)?
- Was ist das QCG?
- Was sind die Rahmenbedingungen des QCG?
- Was sind die Förderungsvoraussetzungen beim QCG?
- Wann ist eine Förderung nach QCG nicht möglich?
- QCG: Die Bitkom-Checkliste für die Antragsstellung
Wichtiger Hinweis: Die Rechtslage zum Qualifizierungschancengesetz (QCG) befindet sich im Wandel. Mein Beitrag fasst den Stand Ende September 2025 nach bestem Wissen und Gewissen sowie nach mehrfacher Gegenrecherche zusammen. Er stellt keine Rechtsberatung dar – ich bin kein Jurist. Bitte prüft im Zweifel die aktuellen Informationen direkt bei der Bundesagentur für Arbeit oder im Gesetzestext.
Auf geht’s:
1. Qualifizierungschancengesetz (QCG): Wer steht hinter dem Leitfaden?
„Leitfaden zur Weiterbildungsförderung nach QCG und Folgegesetzen für Unternehmen“ – so lautet das Dokument des Bitkom. QCG ist die Abkürzung für Qualifizierungschancengesetz.
Der Bitkom ist der zentrale Branchenverband der deutschen Informations- und Telekommunikationswirtschaft. Er vertritt rund 2.000 Unternehmen mit mehr als 2 Millionen Beschäftigten in Deutschland: von Mittelständlern und Start-ups bis hin zu nahezu allen internationalen Technologiekonzernen.
2. Was ist das Qualifizierungschancengesetz (QCG)?
Das Qualifizierungschancengesetz (QCG) soll Arbeitnehmer*innen befähigen, in wirtschaftlich zukunftsrelevanten Bereichen fit zu werden. Es wurde Ende 2018 beschlossen, trat Anfang 2019 in Kraft und fördert die Weiterbildung von Beschäftigten. Erweitert wurde es 2020 durch das Arbeit-von-morgen-Gesetz und 2024 durch das Gesetz zur Stärkung der Aus- und Weiterbildungsförderung.
Problem bis heute: Die Fördermöglichkeiten sind vor allem kleinen und mittleren Betrieben häufig nicht bekannt und werden entsprechend selten genutzt.
3. Was sind die Rahmenbedingungen des QCG?
Ob Unternehmen bei der Mitarbeitenden-Weiterbildung durch das QCG gefördert werden, prüft die Agentur für Arbeit weiterhin im Einzelfall. Seit der Reform 2024 gilt jedoch: Liegen die Voraussetzungen vor, werden die festgelegten Fördersätze automatisch angewendet. Eine klassische Ermessensentscheidung gibt es damit praktisch nicht mehr. Ein Rechtsanspruch besteht, wenn geringqualifizierte Beschäftigte einen Berufsabschluss nachholen.
Die Weiterbildungsförderung umfasst:
- Lehrgangskosten: Übernahme der Weiterbildungskosten für einzelne Beschäftigte.
- Arbeitsentgeltzuschuss: Arbeitgeber erhalten diesen, wenn es weiterbildungsbedingt zu Arbeitsausfällen kommt.
Grundsätzlich beteiligt sich der Arbeitgeber an den Weiterbildungskosten. Wird jedoch mit der Förderung ein Berufsabschluss nachgeholt, können sowohl Lehrgangskosten als auch Arbeitsentgeltzuschuss bis zu 100 % übernommen werden – unabhängig von der Unternehmensgröße. Für Beschäftigte ab 45 Jahren sowie Menschen mit Schwerbehinderung gelten zusätzlich erhöhte Fördersätze.
Seit 2024 gilt:
- Unternehmen mit weniger als 50 Beschäftigten: 100 % der Lehrgangskosten und 75 % Arbeitsentgeltzuschuss.
- Unternehmen mit 50-499 Beschäftigten: 50 % der Lehrgangskosten (100 % bei Mitarbeitenden über 45 Jahren und Mitarbeitenden mit Schwerbehinderung) und 50 % Arbeitsentgeltzuschuss.
- Unternehmen mit 500+ Beschäftigten: 25 % der Lehrgangskosten und 25 % Arbeitsentgeltzuschuss.
4. Was sind die Voraussetzungen für die Förderung nach QCG?
Die Weiterbildung muss mehr als 120 Unterrichtseinheiten (UE) à 45 Minuten umfassen (das entspricht mehr als 90 Zeitstunden). Förderfähig sind grundsätzlich alle Weiterbildungsformate: Präsenz (also vor Ort), digital (also remote) und hybrid (Mischung aus vor Ort und remote).
Der vom Unternehmen gewählte Weiterbildungsträger als auch die Weiterbildung selbst müssen AZAV-zertifiziert sein (= geprüft entlang der „Akkreditierungs- und Zulassungsverordnung Arbeitsförderung“).
Die letzte geförderte berufsbildende Maßnahme sowie der letzte Berufsabschluss der beschäftigten Person muss mindestens 2 Jahre zurückliegen.
Beschäftigte und Unternehmen müssen beide einer Weiterbildung zustimmen, um eine Förderung erhalten zu können.
Wenn die folgenden Fragen bejaht werden, ist die Weiterbildung laut Bitkom voraussichtlich förderfähig:
- Kann das vermittelte Wissen auch in einem anderen Betrieb verwendet werden?
- Kann der Geschäftsbetrieb im Unternehmen auch ohne die Weiterbildung aufrechterhalten werden?
5. Wann ist eine Förderung nach QCG nicht möglich?
Eine Förderung nach dem Qualifizierungschancengesetz ist nicht in jedem Fall möglich. Klar ausgeschlossen sind:
- gesetzlich vorgeschriebene Weiterbildungen (z. B. Pflichtschulungen),
- rein arbeitsplatzbezogene Anpassungsfortbildungen,
- betriebsinterne Maßnahmen, die nicht durch einen externen AZAV-zertifizierten Träger durchgeführt werden,
- Weiterbildungen mit weniger als 121 Unterrichtseinheiten (UE) à 45 Minuten,
- Fälle, in denen der letzte Berufsabschluss oder eine geförderte Weiterbildung weniger als zwei Jahre zurückliegt.
Bei Abschlüssen wie Meister*in, Techniker*in, Fachwirt*in oder Bachelor/Master Professional gilt: Diese werden in der Regel über das Aufstiegs-BAföG (AFBG) gefördert. Ein klarer Ausschluss durch das QCG ist in den öffentlich verfügbaren Informationen zwar nicht ausdrücklich bestätigt, es ist jedoch plausibel, dass hier ein Vorrang des Aufstiegs-BAföG besteht, um Doppelförderungen zu vermeiden.
6. QCG: Die Bitkom-Checkliste für die Antragsstellung
1. Schritt – Weiterbildungsvorhaben gemeinsam mit den Mitarbeitenden identifizieren. Tipp: Digitale Lernformate helfen, Beruf, Weiterbildung und Privates zeitlich zu vereinbaren.
2. Schritt – über Fördermöglichkeiten informieren und beraten lassen. Jedes Unternehmen hat eine zentrale Ansprechperson bei der Agentur für Arbeit.
3. Schritt – Ausfüllen der Antragsformulare: Der ausgewählte Bildungsträger hilft beim Antragsprozess.
Der Bitkom weist darauf hin, dass in vielen Fällen eine Stellungnahme zum Weiterbildungsvorhaben notwendig ist:
- Wie wird die Weiterbildung begründet?
- Welche Vorteile bietet sie für den/die Arbeitnehmer*in?
Qualifizierungschancengesetz: Es geht um die wirtschaftliche Zukunftsfähigkeit Deutschlands
Soweit eine Übersicht zum Qualifizierungschancengesetz (Stand Ende September 2025). Klein- oder schönreden lässt sich das Thema Fachkräftemangel schon lange nicht mehr. Der demografische Wandel belastet fundamental die Wertschöpfungsfähigkeit Deutschlands. Weiterbildung ist ein zentraler Hebel, um die drei „Ws“ auch künftig aufrechterhalten zu können: Wertschöpfung, Wachstum und Wohlstand.
Das Qualifizierungschancengesetz (QCG) ist vor allem für kleine und mittelständische Unternehmen eine große Chance, wettbewerbsfähig zu bleiben und dadurch den Wirtschaftsstandort zu stärken.
Deshalb: Gas geben!
Quelle:
bitkom.org: Leitfaden – Qualifizierung von Beschäftigten in der digitalen Transformation
Link-Tipps hier auf meinem Blog „Der Onliner – Marketing & Wirtschaft 4.0“:
Wirtschaftskrise: Ist die Deindustrialisierung Ursache – oder ist sie Symptom?
